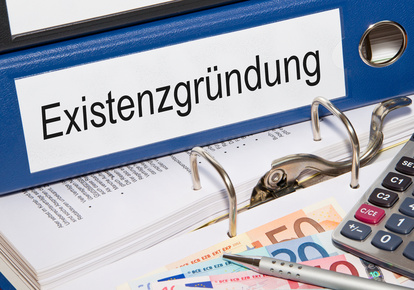Gründungsförderung: Was Deutschland von Frankreich, UK & Italien lernen kann
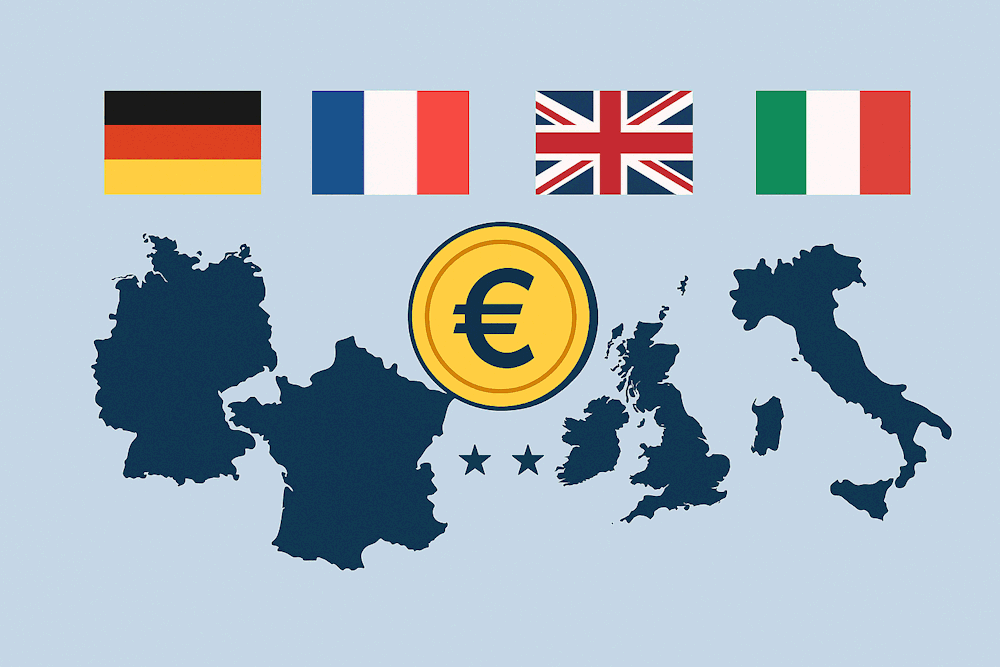
Deutschland bietet Gründerinnen und Gründern bereits viele Förderprogramme, Beratungsangebote und unterstützende Strukturen. Dazu gehören beispielsweise zinsgünstige Kredite der KfW, regionale Wirtschaftsfördermittel, Beratungszuschüsse und Gründerwettbewerbe. Dennoch zeigen internationale Modelle: Es geht noch gezielter, digitaler und unbürokratischer. In Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Italien setzen Regierungen Impulse, die nicht nur administrativ entlasten, sondern auch gesellschaftlich relevante Gründungsthemen stärken.
Ein genauer Blick auf diese innovativen Ansätze kann helfen, auch das deutsche Förderwesen weiterzuentwickeln – hin zu mehr Gründungsfreundlichkeit, Chancengleichheit und Effizienz.
Steuerliche Anreize für private Start-up-Investitionen
In Großbritannien sorgen Programme wie das „Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)“ und das „Enterprise Investment Scheme (EIS)“ dafür, dass Investitionen in Start-ups steuerlich attraktiv werden. Je nach Programm erhalten Investoren Steuererleichterungen von 30 bis 50 Prozent auf ihre Investitionssumme. Zudem können Verluste aus fehlgeschlagenen Investitionen steuerlich verrechnet werden.
Ein vergleichbares Modell in Deutschland könnte vor allem Business Angels und private Mikroinvestoren motivieren, jungen Start-ups frühzeitig Kapital zur Verfügung zu stellen – besonders in der schwierigen Pre-Seed-Phase. Denkbar wären steuerliche Sonderabschreibungen, Verlustverrechnungen oder eine Befreiung von der Abgeltungsteuer bei Reinvestition der Gewinne in neue Start-ups. Dies könnte insbesondere in technologieorientierten Branchen wie KI, MedTech oder GreenTech enorme Wachstumsimpulse geben.
Management-Trainings für kleine Unternehmen zugänglich machen
Das britische Programm „Help to Grow: Management“ bietet Inhabern kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) stark vergünstigte Managementkurse an, durchgeführt von anerkannten Business Schools. Die Inhalte reichen von Strategie und Innovation über Digitalisierung bis hin zu Personalführung. Die Teilnahmegebühren werden zu 90 % vom Staat getragen.
In Deutschland gibt es zwar vereinzelt Programme zur Weiterbildung von Selbstständigen, doch ein flächendeckendes, praxisnahes und staatlich koordiniertes Schulungsangebot fehlt. Eine Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen, Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern könnte die Basis für ein ähnliches Programm schaffen. Ziel sollte sein, nicht nur akademisch fundiertes Wissen zu vermitteln, sondern praxisrelevante Fähigkeiten, die unmittelbar im Unternehmen umgesetzt werden können. Gerade Gründerinnen und Gründer ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund würden davon stark profitieren.
Zentrale Online-Plattform für Gründungsformalitäten schaffen
Frankreich hat mit dem „Guichet Unique“ einen Meilenstein in der Verwaltungsdigitalisierung erreicht: Ein zentrales Online-Portal ermöglicht es Gründerinnen und Gründern, sämtliche Gründungsformalitäten wie Gewerbeanmeldung, Steuerregistrierung, Sozialversicherung und Kammerzugehörigkeit gebündelt an einem Ort und vollständig digital abzuwickeln.
In Deutschland hingegen müssen Gründer noch immer mit mehreren Behörden kommunizieren, teils online, teils in Papierform. Dies führt nicht nur zu Zeitverlust, sondern auch zu Verunsicherung. Ein vergleichbares zentrales Portal, das alle behördlichen Prozesse vereint, könnte den administrativen Aufwand erheblich reduzieren. Pilotprojekte auf Landesebene könnten zeigen, wie ein solcher „One-Stop-Shop“ praxistauglich umgesetzt werden kann. Mittelfristig wäre ein bundesweites Portal denkbar, das auch Schnittstellen zu Notaren, Banken und Handelsregistern beinhaltet.
Zinsfreie Kredite für junge Gründerinnen und Gründer
Italien geht mit dem Förderprogramm „ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero“ gezielt auf die Bedarfe junger Menschen und Frauen ein, die ein Unternehmen gründen möchten. Das Programm bietet zinsfreie Darlehen mit langen Laufzeiten und Tilgungsfreiheit in den ersten Jahren – vor allem für Investitionen in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation.
Auch Deutschland könnte solche spezifischen Förderprogramme ausbauen. Zwar existieren bereits Angebote wie das „ERP-Gründerkredit StartGeld“ der KfW, jedoch fehlen Programme mit klarem Fokus auf unterrepräsentierte Zielgruppen. Zinsfreie oder teilweise rückzahlbare Darlehen für junge Gründer, insbesondere in Kombination mit Coaching und Mentoring, könnten nicht nur finanzielle Hürden abbauen, sondern langfristig die Diversität in der Gründerlandschaft fördern.
Gezielte Unterstützung für soziale Unternehmen stärken
In Frankreich erhalten Unternehmen, die soziale oder ökologische Ziele verfolgen, besondere Förderung unter dem Dach der „Économie Sociale et Solidaire (ESS)“. Neben finanziellen Zuschüssen gibt es spezielle Gesellschaftsformen und vereinfachte Zugänge zu öffentlichen Aufträgen. Solche Unternehmen sind fest im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefüge verankert – ohne rein gewinnorientiert zu arbeiten.
In Deutschland existiert bisher keine spezifische Rechtsform für soziale Unternehmen. Eine Möglichkeit wäre die Einführung einer „gGmbH light“, die wirtschaftliches Handeln erlaubt, aber Gemeinwohlorientierung fest verankert. Ebenso denkbar wären spezielle Förderlinien, Beratungszentren oder Steuererleichterungen für Social Start-ups. Dies könnte den Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle mit gesellschaftlichem Mehrwert deutlich vereinfachen.
Man muss das Rad nicht neu erfinden
Die Analyse internationaler Förderkonzepte zeigt: Deutschland muss das Rad nicht neu erfinden. Vielmehr geht es darum, erfolgreiche Elemente aus anderen Ländern zu adaptieren und auf die hiesigen Strukturen zu übertragen. Steuerliche Investitionsanreize, zentralisierte digitale Behördenprozesse, subventionierte Fortbildungen und zielgruppenspezifische Kredite – all das lässt sich auch in Deutschland umsetzen.
Dabei geht es nicht nur um mehr Förderung, sondern um passgenaue, unbürokratische und praxisnahe Lösungen. Eine moderne Gründungsförderung sollte Vielfalt ermöglichen, soziale Innovationen unterstützen und bürokratische Hürden abbauen. Wer diese Impulse aufnimmt, kann Deutschland als Gründungsstandort entscheidend voranbringen – und gleichzeitig dazu beitragen, dass mehr Menschen mit innovativen Ideen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.
Fazit: Zeit für mutige Schritte in der Gründungsförderung
Der Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und zielgerichtet Gründungsförderung sein kann. Länder wie Frankreich, Großbritannien und Italien setzen auf digitale Effizienz, soziale Verantwortung und konkrete Anreize für private Investoren. Deutschland kann aus diesen Ansätzen wertvolle Lehren ziehen.
Es braucht jetzt den politischen Willen, neue Wege zu beschreiten und bestehende Strukturen zu modernisieren. Nur so kann sich Deutschland als attraktiver und zukunftsorientierter Standort für Gründerinnen und Gründer behaupten. Die Voraussetzungen sind da – es gilt, mutig nach vorne zu denken und innovative Konzepte in die Praxis zu überführen. Eine moderne Gründerlandschaft ist kein Selbstzweck, sondern ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Resilienz, gesellschaftlichen Innovation und nachhaltigen Transformation.
Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich selbstständig bin?
 Als Selbstständiger oder Freiberufler sind Sie nicht mehr in Ihrer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert. Sie müssen sich dort nun auf Antrag befreien lassen. Die künftige Beitragshöhe richtet sich nach Ihrem Einkommen. Die Kosten für Selbstständige betragen im Jahr 2026...
Als Selbstständiger oder Freiberufler sind Sie nicht mehr in Ihrer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert. Sie müssen sich dort nun auf Antrag befreien lassen. Die künftige Beitragshöhe richtet sich nach Ihrem Einkommen. Die Kosten für Selbstständige betragen im Jahr 2026...