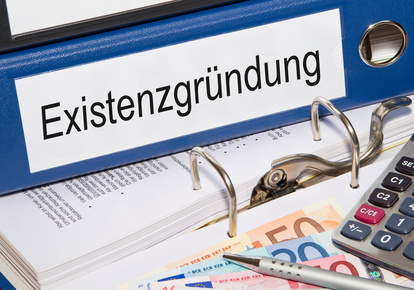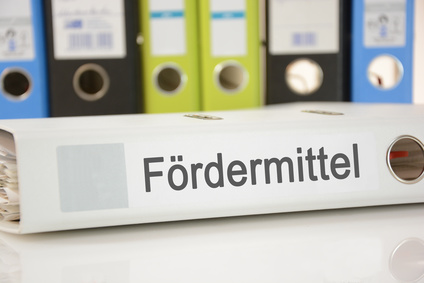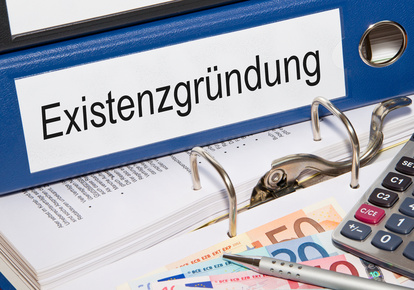Selbstständig machen ohne Eigenkapital: Die 0-Euro Strategie

Wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit plant, ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den erwarteten Kosten unerlässlich. Das Erarbeiten eines Businessplans spielt eine entscheidende Rolle, um die Geschäftsidee sorgfältig zu durchdenken. Dieser Schritt bleibt bedeutend, unabhängig davon, ob eine Finanzierung durch eine Bank angestrebt wird oder nicht. Um herauszufinden, ob die Gründung eines Unternehmens auch ohne Eigenkapital machbar ist, ist es zunächst wichtig, sich einen umfassenden Überblick über die zu erwartenden Kosten zu verschaffen.
In diesem Ratgeber untersuchen wir die vielfältigen Ansätze und Optionen, um eine Selbstständigkeit ohne Eigenkapital zu realisieren, wobei wir uns auf die kosteneffizientesten Finanzierungsmöglichkeiten konzentrieren. Im Vorfeld sollten Sie auch unsere Einstiegsseite gelesen haben, auf der wir die wichtigsten Punkte zur Existenzgründung auf einer Seite zusammengefasst haben:
Diese Kosten kommen auf Sie zu, wenn Sie sich selbstständig machen
Gründungskosten
- Notargebühren für die Registrierung des Unternehmens, falls erforderlich.
- Kosten für die Eintragung ins Handelsregister.
- Kosten für die Beantragung einer Gewerbelizenz.
Rechts- und Beratungskosten
- Honorare für Rechtsanwälte oder Steuerberater zur Beratung in rechtlichen und steuerlichen Fragen.
Büro- und Geschäftsausstattung
- Miete für Geschäftsräume, falls nicht von zu Hause aus gearbeitet wird.
- Kauf von Büromöbeln, Computertechnik und Software.
Marketing- und Werbekosten
- Gestaltung und Druck von Visitenkarten, Flyern und Broschüren.
- Kosten für Webdesign und -hosting für die Unternehmenswebsite.
- Kosten für Online-Marketing und Werbekampagnen.
Produktions- und Materialkosten
- Kosten für Rohmaterialien, falls Produkte hergestellt werden.
- Kosten für die Produktion, inklusive Maschinen und Werkzeuge.
Betriebskapital
- Mittel zur Deckung laufender Ausgaben, bevor regelmäßige Einnahmen generiert werden.
- Kosten für Versicherungen, Lizenzen und Abonnements.
Personalkosten
- Gehälter für Mitarbeiter, falls welche eingestellt werden.
- Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Personalnebenkosten.
Weiterbildung und Qualifikation
- Kosten für Schulungen oder Weiterbildungen, um spezifische Fähigkeiten zu erwerben.
Fahrt- und Reisekosten
- Kosten für geschäftliche Fahrten, Meetings oder Netzwerkveranstaltungen.
Unvorhergesehene Ausgaben
- Rücklagen für unerwartete Kosten oder Notfälle.
Viele angehende Unternehmer scheitern bereits früh, weil sie den Kapitalbedarf völlig falsch einschätzen und sich direkt zu Beginn hoffnungslos überschulden. So engen Sie ihre unternehmerischen Handlungsspielräume stark ein. Eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau belegt, dass nur etwa 10 % der Existenzgründer ohne äußere Finanzmittel auskommen. In fast 50 % der Fälle wird der externe Kapitalbedarf durch ein Darlehen gedeckt. Sofern sie gute Konditionen aushandeln, können Existenzgründer ohne Eigenkapital einen langfristig planbaren Finanzierungsweg nutzen. Dabei verlieren sie ihre unternehmerische Entscheidungsfreiheit nicht. Immerhin gut ein Drittel aller Existenzgründer nutzt Fördermöglichkeiten und Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit, wodurch fehlendes Eigenkapital zum Teil auch kompensiert werden kann. Grundsätzlich ist eine Existenzgründung ohne Eigenkapital möglich, wenn die im Folgenden skizzierten Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. In der Regel beginnen Existenzgründer ohne eigene Kapitaldecke mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, um sich ein gewisses Polster zu schaffen. Zu bedenken ist aber, dass in bestimmten Bereichen gar keine großen Investitionskosten entstehen: Wer z.B. als kreativer Selbstständiger unterwegs ist, braucht oft nicht mehr als einen leistungsstarken PC und eine Internetverbindung. Insofern muss mit Blick auf die Notwendigkeit von Eigenkapital klar differenziert werden: Wer eine GmbH gründet, sollte zumindest über das einzubringende Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro verfügen.
Wege, um eine Selbstständigkeit ohne Eigenkapital zu realisieren
In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen verschiedene Strategien aufzeigen, wie Sie erfolgreich und ohne Eigenkapital ein eigenes Unternehmen gründen können. Jede dieser Methoden kommt mit eigenen Voraussetzungen und Bedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Es ist daher von großer Bedeutung, dass Sie sich mit jeder dieser Optionen detailliert auseinandersetzen. Dies ermöglicht Ihnen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und eine Finanzierungsmethode zu wählen, die genau zu Ihren individuellen Gegebenheiten und Zielen passt.
1. Staatliche Förderprogramme und Hilfen finden und beanspruchen
In vielen Ländern gibt es verschiedene staatliche Förderprogramme für Existenzgründer, die darauf abzielen, die Gründung neuer Unternehmen zu unterstützen und zu erleichtern. Die genauen Programme können je nach Land und Region variieren, aber hier sind einige allgemeine Arten von staatlichen Förderungen, die häufig angeboten werden:
Gründungszuschüsse
- Direkte finanzielle Unterstützung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Oft an bestimmte Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Günstige Kredite und Bürgschaften
- Staatlich subventionierte Kredite mit niedrigeren Zinssätzen als übliche Bankkredite.
- Bürgschaften oder Garantien für Kredite, um die Kreditwürdigkeit zu erhöhen.
Steuerliche Vergünstigungen
- Steuererleichterungen oder -befreiungen für einen bestimmten Zeitraum.
- Möglichkeit, Anlaufkosten abzusetzen.
Beratungs- und Schulungsangebote
- Kostenlose oder vergünstigte Beratungsdienste für Unternehmensgründer.
- Workshops und Seminare zu Themen wie Businessplanung, Marketing, Buchhaltung.
Förderung von Forschung und Entwicklung
- Unterstützung für Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren.
- Kann sowohl finanzielle Zuschüsse als auch Ressourcen wie Zugang zu Laboren oder Expertenwissen umfassen.
Innovationsförderung
- Spezielle Programme zur Unterstützung von Start-ups im technologischen oder digitalen Bereich.
- Kann auch Wettbewerbe und Inkubatorprogramme umfassen.
Förderungen für spezielle Zielgruppen
- Programme, die sich an bestimmte Gruppen wie Frauen, junge Unternehmer, Migranten oder Personen in strukturschwachen Regionen richten.
Ergänzend zu den allgemeinen staatlichen Förderungen für Existenzgründer sind auch die Angebote und Unterstützungen durch Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) von großer Bedeutung:
Industrie- und Handelskammer (IHK)
- Die IHK bietet vielfältige Unterstützung für Unternehmensgründer, darunter Beratungsdienste, Informationsveranstaltungen und Netzwerkveranstaltungen.
- Sie kann helfen, Geschäftskontakte zu knüpfen und bietet Seminare zu Themen wie Unternehmensführung, Recht und Steuern.
- Die IHK ist auch eine Anlaufstelle für Fragen zur Unternehmensregistrierung und -compliance.
Handwerkskammer
- Für Gründer im Handwerkssektor bietet die Handwerkskammer spezifische Beratung und Unterstützung.
- Sie kann bei der Meisterprüfung und bei der Erlangung notwendiger Lizenzen oder Zulassungen im Handwerksbereich helfen.
- Zusätzlich bietet sie Fortbildungsprogramme und kann bei der Vermittlung von Lehrstellen unterstützen.
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- Die KfW ist bekannt für ihre günstigen Kreditprogramme für Gründer und kleine bis mittelständische Unternehmen.
- Sie bietet verschiedene Finanzierungsmodelle an, darunter Gründerkredite, die speziell auf die Bedürfnisse von Start-ups zugeschnitten sind.
- Die KfW unterstützt auch mit Förderprogrammen im Bereich Innovation und Umweltschutz.
Diese Institutionen sind wertvolle Ressourcen für Existenzgründer, da sie nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch wesentliches Wissen und Netzwerke bieten können. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Unternehmertums und der Wirtschaftsentwicklung.
2. Eigene Crowd finden
Gerade das Internet bietet flexible Wege der modernen Unternehmensfinanzierung. Künstler und Projektveranstalter nutzen das sogenannte Crowdfunding zur Finanzierung ihrer Vorhaben (z.B. den Dreh eines Filmes): Über Websites lassen sich Interessenten direkt ansprechen, für das Projekt zu spenden, wobei eine kleine Summe oft schon genügt. Die Spender erfahren dort auch direkt, mit welcher Art von Gegenleistung sie rechnen dürfen. Diese moderne Form der 'Schwarmfinanzierung' bietet sich vor allem im kreativ-künstlerischen Bereich an. Für kapitalintensivere Unternehmen ist auch der Begriff Crowdinvesting geprägt worden. Im Grunde ist eine klare Abgrenzung nicht möglich, jedoch sind hier in der Regel die Investitionssummen höher. Allerdings sollte man sich klar machen, dass eine höhere finanzielle Beteiligung immer auch mit einer größeren Erwartungshaltung einhergeht. In jedem Falle bietet das Internet zahlreiche Vermarktungsmöglichkeiten, um das eigene Geschäft bekannt zu machen. Dies ist ein nicht zu unterschätzender, imagerelevanter Vorteil des Crowdfunding Ansatzes.
3. Bootstrapping
Bei Bootstrapping handelt es sich um eine Finanzierungsform völlig ohne Fremdkapital. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Geld – beispielsweise laufende Einnahmen – möglichst viel zu erreichen. Sie halten dabei Ihre Kosten möglichst klein und machen vieles selbst. Damit generieren Sie dann mit der Zeit kleinere Einnahmen. Die laufenden Einnahmen steigen und somit auch die finanziellen Möglichkeiten. Am Ende generieren Sie dann mit der Zeit kleinere Gewinne. Für viele Gründer, die mit diesem Modell starten, ist das Sparen kein durchdachtes Geschäftsmodell, sondern vielmehr eine Notwendigkeit. Allerdings belasten die massiven Sparmaßnahmen die Gründung und es bleibt nur ein sehr begrenztes Entwicklungspotenzial für das Unternehmen.
Vorteile und Nachteile von Bootstrapping
4. Venture Capital
Die Venture-Capital-Finanzierung ist eine Form der Beteiligungsfinanzierung. Der Geldgeber gibt Geld und bekommt Unternehmensanteile. Die Investoren schließen damit Lücken in der Gründungsfinanzierung und helfen ebenfalls bei langfristigen Expansionen.
Eine Venture-Capital-Finanzierung ist im Gegensatz zur Finanzierung durch eine Bank kein Darlehen. Die Investoren beteiligen sich am Unternehmen und tragen das Risiko mit. Wenn Ihr Start-up scheitert, verlieren die Kapitalgeber ihr investiertes Geld. Deshalb verbinden die Investoren ihr Engagement mit einem gewissen Maß an Managementunterstützung für das junge Unternehmen. Die Investoren erhalten häufig umfangreiche Informations-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte. Außerdem steigen die Investoren in der Zukunft wieder aus dem Unternehmen aus und erwarten sich dann eine außerordentliche Rendite. Damit sind die Erwartungen an die Leistungen und das Wachstum der Gründer sehr hoch.
5. Business Angels
Vermögende Unternehmer agieren gelegentlich als Business Angels. Sie beteiligen sich an einem Start-up, dazu erwerben sie Unternehmensanteile. Meistens investieren sie schon in sehr frühen Entwicklungsphasen, wenn sie von einer innovativen Geschäftsidee überzeugt sind. In der Regel investieren sie in Branchen, in denen sie sich auskennen und entsprechende Erfahrungen mitbringen. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen und auch ihr Netzwerk stellen sie den jungen Unternehmern zur Verfügung. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite und betrachten sich selbst als Geburts- oder Entwicklungshelfer für junge Start-ups.
Business Angels veröffentlichen kein Inserat in der Zeitung. Um an diese finanzielle Möglichkeit zu kommen, müssen junge Unternehmer beispielsweise auf Internetportalen wie dem Business Angels Netzwerk Deutschland auf sich aufmerksam machen. Da die Investments meist nicht sehr groß ausfallen, eignet sich diese Finanzierung sehr gut für die Anfangsphase.
6. Inkubatoren und Acceleratoren
Ein Inkubator investiert nicht nur Kapital in ein Start-up. Er unterstützt junge Unternehmen noch in anderer Weise, indem er auch eine Büroinfrastruktur oder weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das Kapital von einem Inkubator ist meist Venture Capital. Überdies beraten Inkubatoren die Gründer auch und helfen, die Geschäftsidee zu analysieren und zu entwickeln.
Verschiedene Stellen, wie beispielsweise Universitäten, Industrieunternehmen oder Unternehmen der Finanzbranche und Venture-Capital-Gesellschaften, bieten sogenannte Accelerator-Programme an. Dabei steht dem Start-up ein Mentor zur Seite und im Gegenzug erwirbt das kapitalgebende Unternehmen Unternehmensanteile. Dabei ist eine Frage für die Gründer besonders wichtig: Ist die Unterstützung das auch wert? Bei diesen Programmen geht es in erster Linie um Kontakte, Netzwerke sowie unausgeschöpfte Potenziale. Bekommen Sie dies in einem solchen Programm nicht, kann die Teilnahme reine Zeitverschwendung sein.
7. Mitarbeiter zu Gesellschaftern machen
Wenn ein junges Unternehmen bereits Mitarbeiter hat, besteht die Möglichkeit, diese zu Gesellschaftern zu machen. Auf diese Weise können Sie sich das für die weitere Entwicklung notwendige Geld bei ihrer Belegschaft leihen. Als Gegenleistung erhalten die Mitarbeiter Unternehmensanteile.
Damit verbessern Sie Ihre Kapitalstruktur und erhöhen das Fremdfinanzierungspotenzial, also Ihre Attraktivität für externe Kapitalgeber. Gerade kleine Unternehmen, die nur schwer einen Zugang zum Kapitalmarkt finden, haben hier eine interessante Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Dazu muss allerdings die Belegschaft ausreichend groß sein, um die laufenden Verwaltungskosten zu schultern. Außerdem müssen Sie die Mitsprache- und Informationsrechte der so gewonnenen Gesellschafter genauestens klären.
8. Franchise
Die Gründung eines Unternehmens mittels eines Franchise-Modells bietet eine attraktive Alternative zur herkömmlichen Selbstständigkeit und kommt mit einer Reihe von Vorteilen. Ein wesentlicher Pluspunkt ist, dass Sie sich in ein bereits etabliertes und erprobtes Geschäftsmodell einkaufen. Dies reduziert das Risiko erheblich im Vergleich zur Entwicklung einer eigenen Geschäftsidee von Grund auf. In einem Franchise-System erhalten Sie Zugang zu einer bekannten Marke und einem bewährten Konzept, was oft einen vertrauenswürdigen Start in den Markt ermöglicht. Sie profitieren von der Markenbekanntheit und dem Ruf des Franchise-Gebers, was bei der Kundenakquise und beim Aufbau einer Kundenbasis ein entscheidender Vorteil sein kann.
Außerdem erhalten Franchise-Nehmer in der Regel umfangreiche Unterstützung durch den Franchise-Geber. Dazu gehören Schulungen, Marketingunterstützung sowie Hilfestellung bei der Betriebsführung. Diese Unterstützung kann besonders für Unternehmensgründer ohne vorherige Erfahrung in der Selbstständigkeit von unschätzbarem Wert sein.
Ein weiterer Vorteil eines Franchise-Modells ist der Zugang zu bewährten Lieferketten und Unternehmensprozessen. Dies kann die Effizienz steigern und hilft dabei, Fehler zu vermeiden, die oft bei der Neugründung eines Unternehmens auftreten.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Gründung eines Franchise-Unternehmens auch Einschränkungen mit sich bringt. Dazu gehören beispielsweise die Gebundenheit an die Richtlinien und Standards des Franchise-Gebers und möglicherweise anhaltende Franchise-Gebühren. Zudem kann die unternehmerische Freiheit in bestimmten Bereichen eingeschränkt sein, da das Geschäftsmodell und die Betriebsprozesse bereits festgelegt sind.
Insgesamt bietet das Franchise-Modell eine strukturierte und unterstützende Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, wobei es wichtig ist, die Kosten, Verpflichtungen und das Potenzial des jeweiligen Franchise sorgfältig zu bewerten, bevor man sich für diesen Weg entscheidet.
Existenzgründung mit Franchise
Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich selbstständig bin?
 Als Selbstständiger oder Freiberufler sind Sie nicht mehr in Ihrer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert. Sie müssen sich dort nun auf Antrag befreien lassen. Die künftige Beitragshöhe richtet sich nach Ihrem Einkommen. Die Kosten für Selbstständige betragen im Jahr 2025...
Als Selbstständiger oder Freiberufler sind Sie nicht mehr in Ihrer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert. Sie müssen sich dort nun auf Antrag befreien lassen. Die künftige Beitragshöhe richtet sich nach Ihrem Einkommen. Die Kosten für Selbstständige betragen im Jahr 2025...